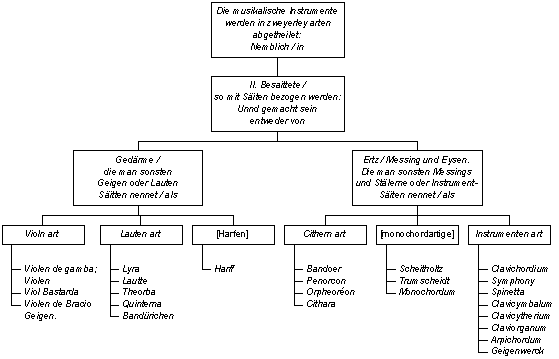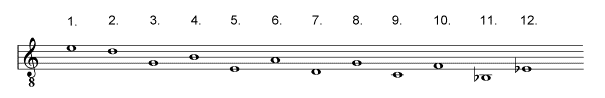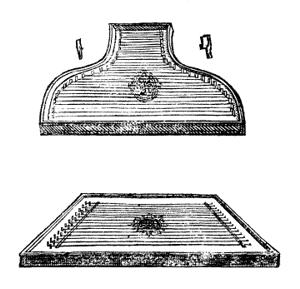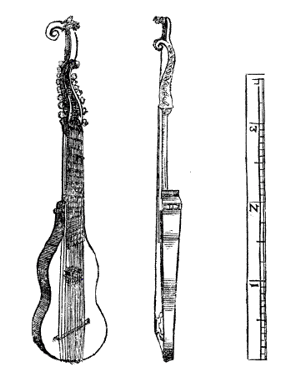| Die Griffbrettzither im Kontext der europäischen Musikinstrumentengeschichte |
| Andreas Michel |
| Für die Geschichte der modernen europäischen Griffbrettzither waren aus entwicklungstheoretischer Sicht zwei Zeitabschnitte von entscheidender Bedeutung: das 16. und das 19. Jahrhundert; das 16. Jahrhundert, weil in ihm die technisch mögliche und naheliegende Entwicklung einer Griffbrettzither mit einer größeren Zahl an diatonisch gestimmten Saiten ausblieb, und das 19.
Jahrhundert, weil in ihm die nun doch etwas überraschend erfolgreiche Etablierung eines solchen Instruments erfolgte. Es überrascht kaum, daß sich der Blick des Historikers auf die beiden erwähnten Zeiträume konzentriert. Sie gelten als die ausschlaggebenden, besonders fruchtbaren und prägenden Phasen in der europäischen Instrumentenentwicklung (vgl. Bär 1998, S. 47ff.). |
| Obwohl die Zither zu den ältesten Saiteninstrumenten gezählt werden kann, in sehr großer Variantenvielfalt auftritt und auf einem elementaren Konstruktionsprinzip fußt, verlief die Geschichte dieses Instrumententyps in Europa – verglichen mit anderen Klangwerkzeugen – keineswegs so geradlinig und logisch oder vielleicht sogar dominant, wie man es auf den ersten Blick
erwarten könnte. Bei der Betrachtung ihrer Geschichte steht man als Historiker zwangsläufig vor besonderen Fragen: Warum fand die Entwicklung der modernen Griffbrettzither nicht schon früher statt? Warum erfolgte der entscheidende Entwicklungsschub gerade im 19. Jahrhundert? Wie gliedert sich das Instrument in das Gesamtgefüge der Musikinstrumente ein? |
| Musikinstrumente durchlaufen in ihrer Geschichte eine Entwicklung, die sich in verschiedenen Stadien vollzieht. Sie läßt sich oft nur schwer rekonstruieren und der Versuch, eine innere Logik aufzudecken, kommt dabei kaum ohne Hypothesen aus. Für die Ausbildung eines bestimmten Musikinstruments oder Instrumententyps muß immer ein entsprechendes Ursache-Wirkungs-Prinzip
und ein entsprechendes Existenzklima vorhanden sein. Dabei wirken eine ganze Reihe unterschiedlicher soziologischer, technologischer, musikalischer, kultureller, regionaler, mitunter sogar klimatischer Faktoren, so daß eine Monokausalität von vornherein ausgeschlossen sein dürfte. Um einen Platz im Musikleben zu erlangen und über einen längeren Zeitraum stabil zu behaupten, müssen
Musikinstrumente zahlreiche Anforderungen in bezug auf spieltechnische Eigenschaften, Ensemblefähigkeit, Klangindividualität, Sozialstatus oder Virtuositätspotential erfüllen. |
| Ist das grundlegende akustische Verfahren eines Klangwerkzeuges entdeckt oder zu einer praktikablen Anwendung gekommen, beginnt in der Regel eine Früh- oder Formierungsphase, in der vor allem eine große Varianten- und Formenvielfalt herrscht. Unterschiedlichste und sehr individuelle Modelle existieren nebeneinander her oder stehen mehr oder weniger in Konkurrenz
zueinander. Erst wenn sich eine Tendenz zur Normierung und zur Herausbildung eines Standardmodells zeigt, kann von einem Ende dieser Formierungsphase gesprochen werden. |
| Man der Instrumentenentwicklung generell drei qualitativ verschiedene Phasen zugrunde legen: |
| 1. Phase |
Formaufspaltung. In dieser Phase vollzieht sich die Herausbildung neuer Formen, man kann sie als "Aufblühphase" bezeichnen, in der eine explosive Stammverzweigung stattfindet. Der entscheidende Entwicklungsschritt zeigt sich in Neuentwicklungen oder Erfindungen. Diese geschehen natürlich nicht voraussetzungslos, bilden aber einen qualitativen Sprung in der
Gesamtentwicklung. In der Instrumentenforschung wird dieser Entwicklungsabschnitt in der Regel als Formierungsphase eines Instrumententyps bezeichnet. |
| 2. Phase |
Spezialisierung: In der zweiten Phase findet die qualitative Vervollkommnung statt. Im wesentlichen handelt es sich um Vervielfältigungsleistungen und um Modifikationen des bereits Bestehenden. Das Identische wird im Gleichen vervielfältigt und erlangt im Ähnlichen seine Modifikation. Typische Vorgänge dieser Art sind Formveränderungen der Korpora, die
Vergrößerung der Saitenzahl bei Chordophonen, die Vermehrung der Effektoren etc. In dieser Entwicklungsphase findet zugleich eine strukturelle und funktionelle Optimierung der Instrumente statt, wodurch die Mannigfaltigkeit wiederum Einschränkungen erfahren kann. |
| 3. Phase |
Überspezialisierung, Degeneration, Aussterben: In dieser Entwicklungsphase finden Exzessiv- und Luxusbildungen statt, zu beobachten sind Formen des Gigantismus und der Hypertrophierung einzelner Elemente. Diese auf Maximierung ausgerichtete Versuche - man denke etwa an Riesenkontrabässe im 18. Jahrhundert - isolieren sich zwangsläufig, da sie einer pragmatischen
Optimierung des Instrumentariums entgegenstehen. |
|
| Wichtig bleibt festzuhalten, daß in den Frühstadien meistens mehrere unterschiedliche Instrumententypen ähnliche musikalische Funktionen bedienen und sich gegenseitig beeinflussen. Eine geradlinige, autarke Entwicklung dürfte geradezu ausgeschlossen sein. |
| Das 16. Jahrhundert |
| Würde die Geschichte der Musikinstrumente folgerichtig und primär technologisch bestimmt verlaufen, wäre die Griffbrettzither bereits im 16. Jahrhundert "erfunden" worden. Die Voraussetzungen jedenfalls waren vollständig gegeben. Im 15. und 16. Jahrhundert, der wohl wichtigsten Phase für die Formierung des neuzeitlichen europäischen Instrumentariums erfahren die
sogenannten "einfachen Chordophone" (im Sinne der Systematik von Sachs und Hornbostel, die diese Bezeichnung gebrauchen, um Zithern von Saiteninstrumenten mit einem Hals, d.h. Lauteninstrumenten, abzugrenzen) jedoch einen Entwicklungsschub in eine völlig andere Richtung: Das besaitete Tasteninstrument tritt in die Musikwelt und erobert sich rasch eine zentrale Stellung innerhalb des
Instrumentariums. Sowohl die mit einer Mechanik ausgestatteten und von Kielen angerissenen Saiteninstrumente, wie Cembalo, Virginal und Spinett als auch die mit Tangenten angeschlagenen Clavichorde sind aus ergologischer Sicht nichts anderes als Zithern mit einem mehr oder weniger kompliziertem Anschlagmechanismus. Beide Typen, Clavichorde wie Kielinstrumente, haben für Besaitung und
Saitenerregung Vorbilder in weitverbreiteten und wesentlich älteren Instrumenten. |
| Spätestens seit dem 14. Jahrhundert ist in Europa das Hackbrett und das Psalterium belegt. Das Psalterium scheint unter den Musikinstrumenten des späten Mittelalters eine wichtige Rolle gespielt zu haben, nicht zuletzt auch auf Grund seines ihm von der christlichen Theologie verliehenen symbolischen Bezuges. Um so erstaunlicher ist die radikale Ausgliederung aus dem
Instrumentarium der Renaissance. Michael Praetorius, der 1619 eine weitgehend vollständige Beschreibung des Instrumentariums der Spätrenaissance gab, war das Psalterium bereits unbekannt; er konnte keine eigene Beschreibung geben, sondern greift auf Sebastian Sebastian Virdungs Musica getutscht aus dem Jahre 1511 zurück: "dieweil ich sonsten keinen Bericht oder Nachrichtung haben können /
wie und welcher gestalt dieselbe uns jetziger zeit unbekante Instrumenta gebraucht worden" (Michael Praetorius: Syntagma musicum II, De Organographia, Wolfenbüttel 1619, S. 76). Und der zitierte Virdung schrieb: "Das psalterium das noch in übung ist / das hab ich nye anderst gesehen dann dryecket / Aber ich glaub und mayn / das das virginale erstmals von den psalterio erdacht sey zemachen
/ das man nun yetz undt mit schlüsseln gryffet / und schlecht / und mit federkilen gemacht ist" (Sebastian Virdung: Musica getutscht und außgezogen, Basel 1511, fol. Ciiiv). Die Formulierung "noch in übung" darf man wörtlich verstehen, denn Virdung zählte das Psalterium gemeinsam mit Trumscheit und kleinen Geigen zu den seiner Meinung nach "onnütze[n] Instrumenta". Die spieltechnischen
Möglichkeiten des Tastenmechanismus, die er deutlich hervorhebt, dürften von beeindruckender Nachhaltigkeit und Überzeugungskraft bei den Musikern gewesen sein. Für die Darstellung kontrapunktischer Musik bietet das Tasteninstrument eine Universalität, die andere Instrumente geradezu ins Hintertreffen geraten läßt. |
| Es ist dennoch bei der ausgesprochenen Experimentierfreude der Instrumentenbauer im 16. Jahrhundert verwunderlich, daß dem gezupften Chordophon vom Zithertypus keine oder ausgesprochen wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Zumal mit Monochord und Scheitholt einerseits und Psalterien andererseits ein fruchtbarer Entwicklungsansatz gegeben war: Die auf der Hand liegende
Kompilation von Scheitholt und Psalterium fand offensichtlich nicht statt. Wenn man bedenkt, daß man in dieser Zeit selbst vor schwierigsten Aufgabenstellungen, wie beispielsweise dem "Nürnbergischen Geigenwerk" nicht zurückschreckte, wird das Erstaunen ob der ausgebliebenen einfachen Konstruktion des neuen Typs einer Griffbrettzither noch gesteigert. |
| Mit Gewißheit darf man behaupten, daß es nicht bauliche oder konstruktive Gründe waren, die die Entwicklung der gegriffenen Zithern stoppten und verhinderten. Auch die Änderung von Klangpostulaten, die hier wirken können, kommen nicht in Betracht. Das Klangideal der Saiteninstrumente in der Renaissance speiste sich nicht nur annähernd ausgewogen aus dem Klang von
Streich- und Zupfinstrumenten sondern ebenso aus der gleichermaßen ausbalancierten Verwendung von Metall- und Darmsaiten. Die Klassifikation von Michael Praetorius zeigt das sehr deutlich: |
Michael Praetorius: Syntagma musicum II, De Organographia, Wolfenbüttel 1619, S. 10:
Klassifikation der Saiteninstrumente |
| |
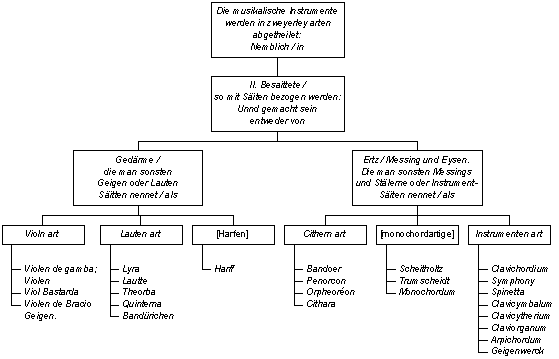 |
| |
| bisweilen auch mit Instrument Säitten bezogen: Geigen. Laute. Theorba. Harff. |
| |
|
| Allerdings offenbart die Zusammenstellung von Praetorius auch, daß das musikalische Postulat von Instrumenten mit obertonreichen, metallisch klingenden Saiten ausreichend von den Zistern – der historische Name für diese Kastenhalslauten war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts "Cither" – abgedeckt wurde, zumal bei ihnen eine Familienbildung vom Baß bis zum Diskantinstrument
erfolgte. Dem Baßinstrument der Zisternfamilie, das allerdings ein Unikum blieb, lag sogar das Prinzip der "modernen" Zitherstimmung in Quinten zugrunde. |
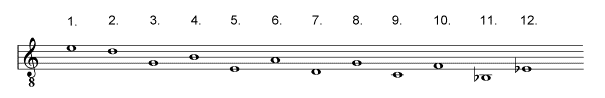 |
Praetorius 1619, S. 29; Stimmung der "Dominici Zwölff Chörichte Cither" |
|
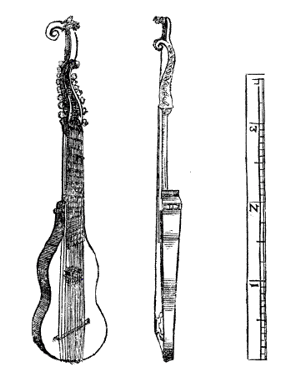 |
Praetorius 1620, Taf. VII: 1. "Dominici Zwölff Chörichte Cither"
"Noch wird eine grössere Art von Cithern gefunden mit 12. Choren / welche ein herrlichen starcken Resonanz von sich gibt / gleich als wenn ein Clavicymbel oder Symphony gehöret würde: Und zu Praga bey einem Keyserlichen vornehmen Instrumentisten, Dominicus genant / eine solche zu finden: Welche fast so lang als eine Baßgeige seyn sol." (Praetorius 1619, S. 55) |
|
| Die Klassifikation offenbart aber bei den darmbesaiteten Instrumenten eine offensichtliche Fehlstelle: Eine entsprechende Kastenzither ist nicht vorgesehen. Dabei hätte ein darmbesaitetes Zitherinstrument die Variantenvielfalt der Zupfinstrumente unter klangästhetischen Gesichtspunkten sinnvoll ergänzen können. Der musikalischen Ästhetik der Renaissance fielen zahlreiche
Instrumente und Instrumententypen zum Opfer. Vor allem waren das die sogenannten "Pulsatilia", d.h. idiophone und membranophone Schlaginstrumente wie Xylophone ("Strohfideln"), Becken, Schellen, Triangel mit Klirringen, kleine Trommeln und Päuklein; andere geschlagene Instrumente, vor allem das Hackbrett; die Borduninstrumente wie Sackpfeife, Drehleier, Rebec, Fidel und Scheitholt sowie
weitere Instrumente mit geringerem Tonumfang (z.B. Trumscheit). |
| Für eine Ausgliederung des Psalteriums, das keines dieser Kriterien bediente, existierten eigentlich keine hinreichenden ästhetischen Gründe. Folgerichtig findet sich dann auch, allerdings erst auf der letzten Seite der Organographia, im Index, eine interessante Bemerkung von Praetorius zu einem Instrument in "Art eines Hackebrets"
bzw. "in gestalt eines Hackebret", das "aber mit Fingern gegriffen" wird
und das er gemeinsam mit einer Harfenlaute (Zitherlaute?) zu neu erfundenen Instrumenten zählt. Es handelt sich um ein trapezförmiges Psalterium mit 16 Saiten an ebenso vielen Anhängestiften, jedoch 24 Stimmwirbeln. Die Saiten verlaufen in einer Ebene, Teilungsstege sind – im Gegensatz zu dem auf Tafel XVIII abgebildeten Hackbrett - nicht vorhanden. Möglicherweise handelt es sich hier um
den Versuch einer Darstellung des Salterio. Aus organologischer Sicht muß das Salterio allerdings als gezupftes Hackbrett betrachtet werden; die Möglichkeit eigenständiger, vom Hackbrettbau unterschiedener Bauformen wäre noch zu untersuchen. |
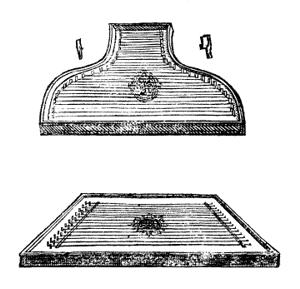 |
Praetorius 1620, Taf. XXXVI, Nr. 1 und 3 : "I. ein Art eines Hackebrets / wird aber mit Fingern gegriffen. 3. Ein gar Alt Italianisch Instrument. darvon hinten im Indice bericht zufinden."
Praetorius 1620, Index : "98. Zwey New erfundene Instrumenta, daß Eine in gestalt eines Hackebrets"
"Noch ein alt Italianisch Instrument / Num: 3. so von dem gemeinen Mann in Italia genennet wird / Istromento di porco, zu Teutsch / eine Saw oder Schweinekopff: von Ludovico de Victoria, Istromento di Laurento: von Iosepho Zarlino Clodiensi, Musicorum Principi, Istromento di alto Basso. Auff der einen seiten sind die Wirbel von Weissen Knochen / etwas lenger als die eiserne uffn
Clavicymbeln zu pflegen / haben in der mitten ein Löchlin / dadurch die Säiten gezogen werden: uff der andern seiten sind die Wirbel aus Holz geschnitten / inmassen der daselbst beygefügte Abriß außweiset. Der Säiten sind an der Zahl dreyßig / und eine immer lenger als die ander." (Index) |
|
| Das 19. Jahrhundert |
| Mit der Ausgliederung des Cembalos aus dem Instrumentarium der europäischen Klassik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und der damit verbundenen Abkehr vom Klang angerissener Metallsaiten formt sich das in seinen Grundzügen bis heute nachwirkende Postulat des Ensemble- (Orchester-) klanges ohne Zupfinstrumentenklang. Gitarre, Harfe, Mandora, Mandola (Mandoline)
finden keinen Eingang in Standardbesetzungen und verbleiben folglich in bestimmten Formen der Kammer- und Hausmusik oder erfahren als Dilettanteninstrumente sogar pejorative Wertungen. Nur in bescheidenem Umfang treten sie als solistische Instrumente im Konzert hervor. |
| Der klassische Orchesterklang vereint Instrumente, bei denen die Tongebung nach dem Einsatz weiter beeinflußt werden kann. Streichinstrumente, Flöten, Oboen, Fagotte und Hörner können präzise Tondauern und Artikulationen auch nach dem Einschwingvorgang ermöglichen. Damit kommen sie einem Klangpostulat, das "Sanglichkeit", Dynamik, Expressivität und variable Klangbildung
- nach dem Vorbild der menschlichen Stimme - verlangt, wohl am ehesten entgegen. Tondauern, die gehalten und dynamisch beeinflußt werden können sowie die Verfügungsmöglichkeit über an- und abschwellende Lautstärken sind Parameter zur Gestaltung des Orchesterklanges, die sich auch mit der Erweiterung des Orchesters im 19. Jahrhunderts nicht grundsätzlich ändern. Instrumente, die angezupft
oder angerissen werden, treten aus eben diesen Gründen in den Hintergrund. In der europäischen Musik dominiert der Streicherklang – eine Merkmal, das für keine andere Kultur zutreffen dürfte. Vor diesem Hintergrund oder richtiger: unter dem Diktat dieses Klangpostulats sind Kreationen wie das Guitarre-Violoncello oder Arpeggione und die Petzmayersche Streichzither, beide um 1823
entwickelt, zu verstehen. Sie sind Versuche, den Spielern von Zupfinstrumenten die Klangwelt der Streichinstrumente zu öffnen (aber nicht vice versa). |
| Die Zither des frühen 19. Jahrhunderts entstammt, wie die überlieferten Instrumente zeigen, der Volkskultur. Das trifft sowohl auf die Herstellung als auch auf das Repertoire zu. Allerdings gelangt das Instrument recht zügig in die Hände professioneller Instrumentenmacher und Musiker, so daß bereits um die Jahrhundertmitte ein deutlicher Wandel im Sozialstatus der Zither
eintritt: Das Bürgertum und in gewissem Maße auch der Adel wird zu einer wichtigen sozialen Trägerschicht. Damit kann das Zitherspiel zugleich von dem Standard bürgerlicher Musikpflege profitieren: die traditionellen Wege der Ausbildung, des Konzertwesens, der Musikverlage etc. öffnen sich dem Instrument. Mit dieser Institutionalisierung wird der Konkurrenzdruck gegenüber anderen, bereits
etablierten Instrumenten, vor allem Klavier und Gitarre, erhöht. Die zunehmende Annäherung der Volkskultur, besonders in Mitteleuropa, an die kleinbürgerliche Kultur wirkt zusätzlich als Ferment. In einer Zeit, in der für das Klavier der gußeiserne Rahmen erfunden wird, ohne den man sich den modernen Klavierbau überhaupt nicht vorstellen kann, beginnt sich im Zitherbau das Ende der
Formierungsphase erst allmählich abzuzeichnen. |
| Im wesentlichen knüpft der Zitherbau des 19. Jahrhunderts an Entwicklungsstränge an, die im 15. Jahrhunderts abrissen. Alle baulichen Elemente, die im frühen Zitherbau zur Anwendung und Entwicklung kamen – man denke beispielweise an die Instrumente von Ignaz Simon oder Franz Kren -, hatte es bereits dreihundert Jahre zuvor gegeben: symmetrische und asymmetrische
Korpusformen, die für unterschiedliche Mensuren ausgelegt waren (Praetorius beschreibt ein solches dreißigsaitiges Psalterium mit gelochten Stimmwirbeln aus Bein und Anhängestiften aus Holz), Griffbretter mit diatonischen und teilchromatischen Bundanordnungen usw. Nicht nur die Korpusgestaltung, sondern auch deren konstruktive Anlage erfährt Anregungen aus dem Gitarren- und Zisternbau,
später auch aus dem Klavierbau, wie beispielsweise an Zithern von Franz Xaver Kerschensteiner beobachtet werden kann. |
| Am Ende des 19. Jahrhunderts waren es allerdings zunächst soziologische Gründe, die der Zither zu einer gesicherten Existenz im Musikleben verhalfen: das Entstehen einer kleinbürgerlichen Musikkultur. Deren Bestreben nach Identität kam ein Instrument wie die Zither ideal entgegen. Die Verwurzelung in der traditionellen Volksmusik, die Erschwinglichkeit im
Anschaffungspreis, die Eignung zur Gemeinschaftsbildung im Ensemble und eine identitätsstiftende Funktion im Vereinsleben sind Faktoren, die für die massenhafte Verbreitung der Zither von nicht zu unterschätzender Bedeutung waren. |
| Heute sind diese, für die damalige Demokratisierung des Musiklebens der unteren sozialen Schichten wichtigen Faktoren, sicher in den Hintergrund getreten. Mehr denn je sind es ästhetische Aspekte, die für die Perspektiven der Zither und Zithermusik eine Rolle spielen. Der seit dem 20. Jahrhundert herrschende Stilpluralismus, die Aufweichung musikalischer Gattungen und
Genres, die interkulturellen Strömungen und die immer wieder neu zu stellende Frage nach Sinn, Zweck und Funktion von Musik eröffnen eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten. Diese positiv zu sehen und zu nutzen dürften der Zither eine spannende Zukunft garantieren. |
| Publiziert in: 14. Zithermusiktage, 13.-15. Oktober 2000, Wasserburg am Inn, München 2000, S. 17-24 |
| Inhalt | Zithern Übersicht | Bibliographie |
| © STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2007 |